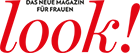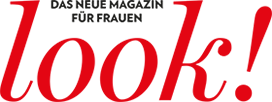Uschi Pöttler-Fellner sprach mit Anna Badora, der ehemaligen Intendantin des Grazer Schauspielhauses, über die emotional aufwühlende Arbeit an ihrem aufsehenerregenden Buch.
Uschi Pöttler-Fellner: Liebe Anna, was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet ein Buch über Gefängnisinsassinnen zu schreiben?
Anna Badora: Einige meiner Interviewpartnerinnen für mein letztes Buch „Dreizehn Leben“ behaupteten, sie verdanken ihren Erfolg nicht nur ihrem Talent, Zielstrebigkeit und enormen Fleiß, sondern auch dem Glück, „die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle“ gewesen zu sein. Ich fragte mich dann, was passiert mit Frauen, wenn sich die Umstände nicht so glücklich fügen? Dann habe ich noch eine frühere Mitarbeiterin getroffen, die, für alle völlig überraschend, zwei Jahre im Gefängnis verbracht hat. Sie suchte verzweifelt einen Job, klagte über Ausgrenzung, Stigmatisierung und Doppelbestrafung. In den vielen Interviews wurde mir dann zunehmend klar, dass unsere Trennung in „wir hier die anständigen Bürger“ und dort „die Kriminellen am Rande unserer Gesellschaft, die bekommen, was sie verdienen“, anmaßend ist. Und wie schnell solche Schicksale auch mit unserem Leben zu tun haben können.
Hattest du Berührungsängste bzw. hatten die Frauen im Gefängnis Vorbehalte, mit dir zu sprechen?
Bevor ich die Frauen traf, wusste ich von ihnen gar nichts, nicht mal ihre Namen und das Alter, geschweige denn ihre Delikte. Nach dem strengen Datenschutz im Gefängnis durfte ich das alles nur von ihnen selbst erfahren. Ich hatte also keine Ahnung, was mich erwartet und welche Charaktere hinter dem Stereotyp „Verbrecherin“ mir gegenübersitzen würden. Klar, dass mich das anfangs stark verunsicherte. Den Insassinnen ging es, wie ich später erfuhr, auch nicht anders. Sie wussten nicht, ob ich in ihren Straftaten nur die reißerischen Storys suchte, also die Sensationslust der Leserinnen bedienen wollte. Wir sprangen alle ins „kalte Wasser“. Und sie und ich wurden dann mit spannendem Austausch belohnt.
Wie viele Gespräche waren nötig, bis sich deine jeweilige Interviewpartnerin öffnen konnte?
Unterschiedlich. Manche vertrauten mir bereits nach den ersten paar Fragen, bei anderen wich erst im dritten Gespräch die Verkrampfung.
Kannst du nachvollziehen, dass man plötzlich, ohne „kriminell“ zu sein, straffällig wird?
Ich staunte, wie schnell unter bestimmten unglücklichen Umständen die schmale Grenze zwischen einer „anständigen“ bürgerlichen Frau zur verurteilten Verbrecherin überschritten werden kann. Und wie erschreckend die Auslöser ihrer Taten auf die Lage der Frauen in unserer heutigen Welt hinweisen.
Da waren Insassinnen, die unter dem Drang zur Selbstoptimierung zusammenbrachen, manche hatten den ständigen Trieb, unbedingt zu einer Gemeinschaft gehören zu wollen, andere das zwanghafte Bedürfnis, Anerkennung zu finden, aber fast alle wollten vor allem eins, geliebt werden. Diese Bedürfnisse, monströs gesteigert, führten dann bei meinen Interviewpartnerinnen zu den Katastrophen, die sie ins Gefängnis brachten.
Wie war dein Eindruck von den Gefängnissen? Könntest du es dort länger als einen Tag aushalten?
Allein schon meine Besuche in den Strafanstalten waren sehr beklemmend. Der Gang durch zwei Sicherheitsschleusen mit Panzerglas-Türen und dann durch die nicht enden wollenden Korridore stimmten mich depressiv. Ich hatte den Eindruck, dass die Zeit drinnen stehen blieb, während sie „draußen“ weiterlief. Ich war jedes Mal froh, wenn ich mein Handy wieder an mich nehmen und durch die Schleuse zurück ins echte Leben treten durfte. Aber wie mir Insassinnen berichteten, existiert im Gefängnis eine eigene Parallelwelt, die durch die eigene feste Ordnung, Regeln und Hierarchien dem Leben mancher Gefangenen Struktur gibt, die sie draußen nie hatten. Eine der interviewten Frauen erzählte, dass sie sich hinter der geschlossenen Zellentür zum ersten Mal seit Langem geborgen fühlte und wieder durchschlafen konnte, weil sie vor ihrem gewalttätigen Mann sicher war.
Eine andere hatte sich vorgenommen, in ihrer 8 qm kleinen Zelle täglich 10.000 Schritte zu gehen, um fit zu bleiben. Sie hat es durchgehalten – volle vier Jahre lang.
Hadern die verurteilten Frauen mit ihrem Schicksal oder nehmen sie es an?
Keine der Interviewten behauptete, sie sei unschuldig. Sie nahmen ihre Schuld an, auch gegenüber den Opfern, lernten, mit ihr bis zum Ende ihrer Tage zu leben. Aber viele, wie die Mutter, die ihre Tochter tötete, verstehen nicht, wie sie ihre Straftaten begehen konnten: „Das war doch nicht ich“, bekam ich oft zu hören.
Was ist der größte Wunsch dieser Frauen?
Dass sie eine zweite Chance bekommen, sich ein Leben nach der Haft neu aufbauen zu können. Und dass die Gesellschaft sie nicht zum zweiten Mal verurteilt.
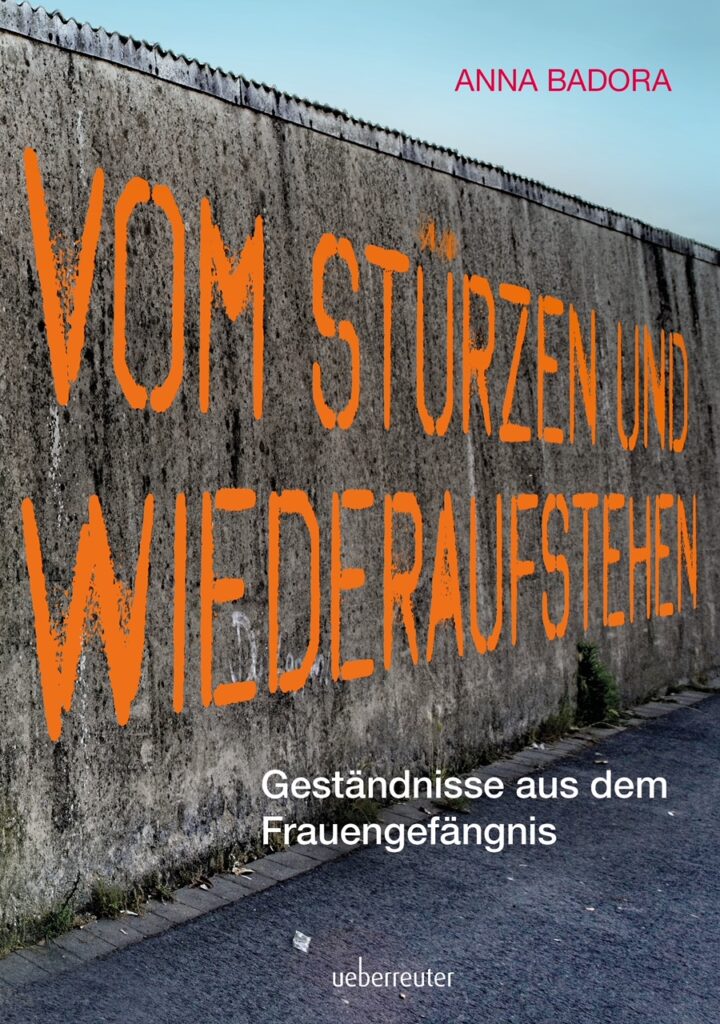
NEU. „Vom Stürzen und Wiederaufstehen“ von Anna Badora, erschienen im Ueberreuter Verlag.
Beitragsbild: © beigestellt